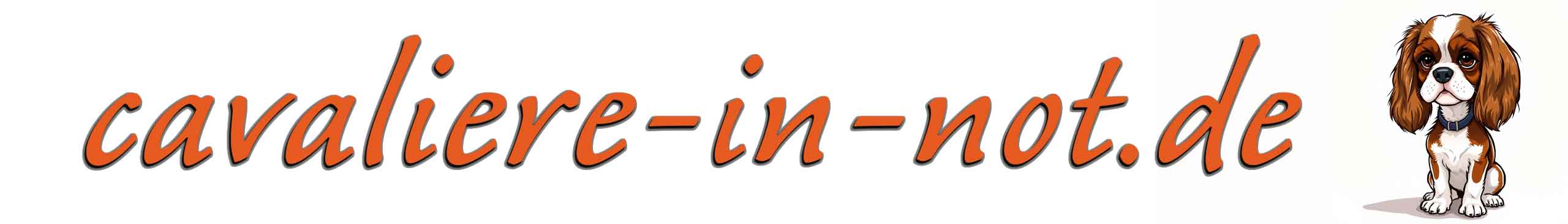„Der Moment, in dem die Hand kommt“
Quelle: Cavalier King Charles Spaniel Insider
Ich erinnere mich zuerst an den Klang.
Das gleichmäßige Schmatzen meiner Geschwister, das ruhige Atmen von Mama. Ihr Herz ist mein Metronom. Wenn es langsam schlägt, ist die Welt in Ordnung.
Wir sind zu viert. Wir wissen nichts von Weihnachten, Geschenken oder Plänen. Unsere Welt besteht aus Wärme, Milch und diesem einen sicheren Ort: dicht an Mamas Körper, eingekuschelt in ihr Fell.
Wenn ich die Augen öffne, sehe ich nur Lichtflecken, Schatten, Bewegungen. Klar ist nur eins: Wo Mama ist, bin ich sicher.
Heute ist es anders.
Die Luft im Zimmer riecht ungewohnt. Da ist der Geruch von Schnee, kalter Luft, Parfüm, fremden Schuhen. Stimmen dringen zu mir durch – höher, lauter, schneller als die, die ich kenne.
Mein kleiner Körper spannt sich an, ohne dass ich weiß, warum.
Für ein Hundebaby in meinem Alter bedeutet „Fremdes“ immer erst einmal: Gefahr. Mein Gehirn ist noch nicht in der Lage, das einzuordnen. Es kennt nur zwei Zustände: sicher bei Mama – oder verloren.
Ich drücke mich dichter an ihren Bauch. Instinkt.
Sie legt ihre Pfote etwas fester um uns und atmet tiefer. Ihr Körper sagt mir: Bleib hier, bleib bei mir.
Doch die Stimmen kommen näher.
„Oh, schau mal, der da! So süß!“
Das Mädchen lacht. Ihre Worte sind für mich bedeutungslos, aber die Lautstärke, das Tempo, das alles rauscht wie ein Gewitter in meinem Kopf.
Ich merke, wie mein Herz schneller schlägt. Stresshormone überfluten meinen Mini-Körper, der noch gar nicht gelernt hat, sich selbst zu beruhigen. Dafür brauche ich Mama. Ihren Geruch. Ihre Zunge, die mir über den Kopf streicht. Ihre Wärme, die meinem Nervensystem sagt: Du lebst, du bist sicher.
Dann passiert es.
Eine fremde Hand greift nach mir.
Kein Vorwarnen, kein langsames Annähern, kein Zeitlassen zum Schnuppern. Einfach: greifen.
Für Menschen ist es ein „Hochnehmen“.
Für mich ist es ein abruptes Herausreißen aus dem einzigen sicheren Ort, den ich kenne.
Mein Bauch verliert den Kontakt zu Mamas Fell.
Ihre Wärme bricht ab wie ein gerissener Faden.
Der Geruch meiner Geschwister wird schwächer.
Ich strample, ohne es zu wollen. Mein kleiner Körper versucht, zurückzukehren dorthin, wo er überleben kann.
Aber die Hand hält mich fest.
Ich werde in die Luft gehoben. Meine Pfoten finden keinen Halt, kein Tuch, keinen Boden. Für mich bedeutet das: Ich verliere Kontrolle. In der Natur heißt so ein Gefühl: Jetzt stirbst du.
Mein kleines Herz arbeitet auf Höchstleistung. Alles in mir schreit: Zurück! Zurück! Zurück!
Doch meine Kehle bringt nur ein dünnes, verzweifeltes Fiepen hervor. Niemand dort oben versteht meine Sprache.Im Gegenteil! Die Menschen lachen mich aus, weil ich Todesangst habe!
Um mich herum nur Fremdes:
Fremde Gerüche, fremde Haut, fremde Stoffe, fremde Stimmen.
Der vertraute Geruch von Mama ist plötzlich weit weg – so, als wäre zwischen uns eine unsichtbare Wand.
Für ein Menschenkind wäre es, als würde man es ohne Vorwarnung aus dem Bett reißen und in einen dunklen, lauten Raum in einer anderen Kultur tragen, in dem niemand seine Sprache spricht. Ohne zu erklären. Ohne Übergang.
Was von außen „nur ein paar Minuten“ sind, ist in meinem Inneren eine Ewigkeit.
In so einem Moment passiert im Gehirn eines Welpen etwas, das sich tief einbrennen kann:
Fremde Hand = Abriss der Sicherheit.
Fremde Hand = Verlust von Mama.
Fremde Hand = Todesangst.
Unten höre ich ein leises Winseln. Es sind meine Geschwister. Sie suchen mich, tasten mit ihren Pfoten ins warme Nest – und finden nur Leere an der Stelle, an der ich gerade noch gelegen habe. Auch ihre kleinen Nervensysteme schlagen Alarm: Einer fehlt. Etwas stimmt nicht.
„Der hier ist perfekt!“, ruft das Mädchen. Es klingt fröhlich. In meinem Inneren ist nichts fröhlich.
Ich kann den Boden nicht sehen, ich rieche Mama nicht mehr, ich kann mich nicht verstecken. Das ist für ein Hundebaby nicht „ein bisschen aufregend“, sondern blanke Todesangst. Mein Körper ist überzeugt: Wenn niemand mich zurückbringt, werde ich sterben.
Dann spricht meine Züchterin. Ihre Stimme klingt verändert, fester, als sie sagt:
„Er ist noch sehr jung. Für ihn ist so eine Trennung ein Schock. Sie müssen verstehen – für ein Cavalier-Baby ist die Bindung zur Mutter nicht nur ‚nett’, sie ist überlebenswichtig. Sein Nervensystem kann Stress noch nicht allein regulieren.“
Sie spricht weiter.
Von Cavalieren, deren Herzen anfällig sind.
Von kleinen Körpern, in denen sich Schmerzen verstecken können, weil die Nerven im Kopf nicht genug Platz haben.
Von dem, was es bedeutet, wenn man auf diese sensiblen Seelen noch zusätzlichen, plötzlichen Stress legt.
„Wenn Sie ihn jetzt einfach mitnehmen, spürt er nur eins“, sagt sie leise, aber bestimmt. „Verlust. Tiefe, existenzielle Angst. Kein langsames Kennenlernen, keine Möglichkeit, sich vorzubereiten. Nur: Die Hand kommt – und alles, was Sicherheit war, ist weg. Ich sterbe.“
Ich weiß nicht, was ihre Worte bedeuten.
Aber ich spüre, wie ihre Hände mich anders halten. Ruhiger. Bewusster. Sie dreht mich so, dass ich wieder Richtung Boden riechen kann. Richtung Mama.
„Darf ich Ihnen erklären, was da gerade in ihm passiert?“, fragt sie.
Und zum ersten Mal seit ich hochgehoben wurde, geht es nicht um „süß“ – sondern um mich. Um das innen drin, das niemand sieht.
Die Mutter des Mädchens schweigt.
Ich höre ihren Atem. Er geht schneller. Dann sagt sie halblaut:
„Ich… habe gar nicht darüber nachgedacht, was das für ihn ist. Ich dachte, Hunde sind robust.“
Robust.
In meinem kleinen Körper fühlt sich nichts robust an.
Alles ist weich, verletzlich, voll Vertrauen – und gerade eben völlig schutzlos.
„Gerade Cavalier-Welpen sind extrem sensibel“, erklärt meine Züchterin. „Sie spüren alles. Stimmen, Stimmungen, Hektik. Wenn man sie so jung abrupt herausnimmt, erlebt ihr System das wie einen Einbruch – als würde der Boden unter den Pfoten verschwinden.“
Ich spüre, wie meine Muskeln ein wenig nachlassen, weil sie mich näher an ihren Körper nimmt und langsam wieder absenkt. Der vertraute Geruch von Mama steigt mir in die Nase, zuerst schwach, dann stärker, wie eine Welle, die endlich wieder kommt.
In dem Moment, in dem meine Pfoten das Tuch berühren, atmet mein ganzer Körper auf.
Ich zittere. Aber ich lebe.
Mama reckt sofort den Kopf, drückt ihre Nase in mein Fell, schiebt mich mit einer entschlossenen, fast strengen Bewegung wieder an ihren Bauch. Ihre Zunge fährt über meinen Rücken, immer wieder, als würde sie sagen:
„Du bist da. Du bist da. Du bist da.“
Mein Herz schlägt noch schnell, aber der Rhythmus des ihren fängt es auf.
Langsam. Ruhiger. Wieder ein bisschen heil.
Die Erwachsenen sprechen weiter.
„Vielleicht… sollten wir das überdenken“, sagt der Vater. „Ich wollte nicht, dass er so Angst hat. Wir wollten doch nur eine Freude machen.“
Das Mädchen ist still geworden. Schließlich flüstert sie:
„Wenn er so Angst hat… dann ist es für ihn kein Geschenk.“
Für mich ist es in diesem Moment schlicht: überleben oder nicht.
Was diese Menschen heute entscheiden, wird mein Leben prägen:
Ob ich Weihnachten als plötzlichen Bruch mit allem, was sicher war, in mir trage –
oder als Tag, an dem ich bei meiner Mutter bleiben durfte, bis mein kleines Herz und mein kleines Gehirn bereit waren, mehr Welt zu ertragen.
Die Tür schließt sich irgendwann.
Es wird wieder leiser im Zimmer. Nur Mamas Herz, das Schmatzen meiner Geschwister, das Rascheln des Tuchs.
Ich weiß noch immer nicht, was Weihnachten ist.
Aber ich weiß:
Damals, als die fremde Hand kam
und mein Inneres sicher war, dass jetzt alles zu Ende ist,
gab es irgendwo einen Moment, in dem ein Mensch begriff,
dass mein Schmerz echt ist.
Und vielleicht beginnt Verantwortung genau dort:
Wo wir die Angst im Welpen nicht mehr „Niedlichkeit“ nennen,
sondern endlich beim Namen: Trauma.
Eins, das wir verhindern können – indem wir ihn nicht aus der Sicherheit reißen,
nur weil draußen gerade Weihnachten ist.

Buchtipp: Schöne Hunde, sensible Herzen. Jetzt auf Amazon